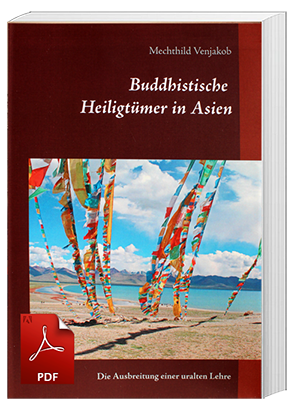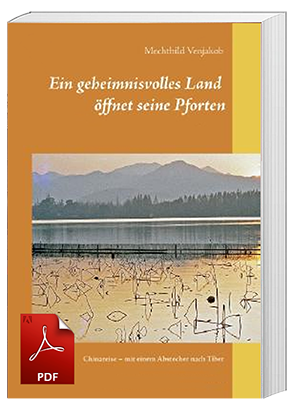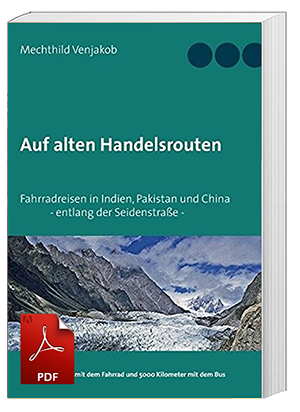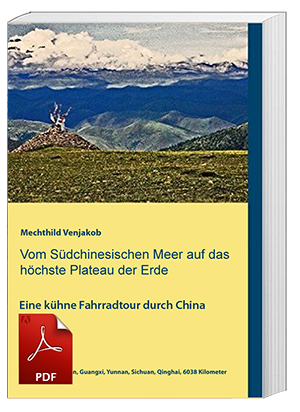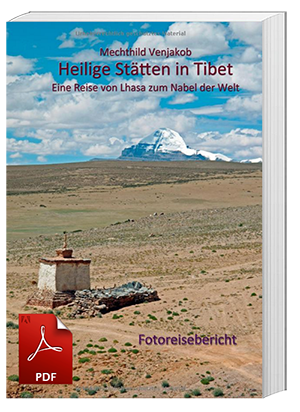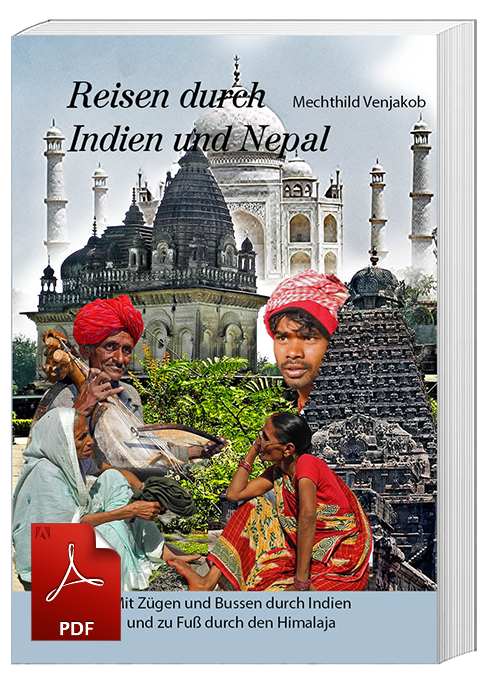Die beschriebenen Reisen durch Indien und Nepal fanden in den Jahren 1981 und 2012/2013 statt. Spannend ist der Vergleich, wie und was sich im Laufe der Zeit geändert hat - und was nicht!
Leseprobe
In Indien:

In diesem uralten Pilgerort am Ganges schlägt das Herz Indiens. Varanasi ist die Stadt des Lebens und des Sterbens, die Stadt der Toten und der Verbrennungsplätze am Ganges, der Andacht und der rituellen Waschungen. Die Engländer nannten sie Benares. Die Hindus nennen sie Kashi, die Stadt des Lichts. Hier verehren sie Shiva als Retter. Varanasi ist auch die Stadt der Seidenwebereien und des Brokats.
Andrea und ich finden in der Nähe der Ghats, der Treppenstufen zum Ganges hinunter, ein Hotel und ziehen in ein Dreibettzimmer ein. Wir befinden uns am Westufer und blicken der aufgehenden Sonne ins Angesicht. Das Ostufer ist flach, sandig und leer. Dort steht kein einziges Haus. Rund einhundert Ghats, zahlreiche Tempel, Schreine, Havelis, Hotels, Herbergen und Shops säumen auf unserer Seite über mehrere Kilometer den heiligsten Fluss Indiens, der die Göttin Ganga verkörpert.
Ganga floss einst als Milchstraße am Himmel. Bhagiratha, ein Asket, bat Ganga auf der Erde zu erscheinen, damit sie die Menschen von Sünden reinwasche. Nach Jahren des Bittens willigte sie ein, aber ihre Wassermassen drohten die Erde zu zerschmettern. Shiva wendete das Desaster ab. Er streckte seinen Kopf in die Fluten, um sie zu bremsen. Das Wasser teilte sich, floss die wilden Haarzotteln des Gottes entlang und die sieben heiligen Ströme Indiens entstanden: der Ganges mit der Yamuna, seinem wichtigsten Nebenfluss, der Godavari, Sarasvati, Narmada, Sindhu und Kaveri. Der zweitausendsechshundert Kilometer lange Ganges ist der heiligste.

Die Stadt des Lichts ist für Hindus, was für Muslime Mekka ist. Hierher kommen sie, um sich von ihren Sünden reinzuwaschen. Glückselig ist, wer in Varanasi sterben darf. Er wird verbrannt und seine Asche in den Ganges gestreut. Er wird vom Kreislauf der Wiedergeburten erlöst, denn seine Seele wird eins mit Brahman, dem Urgrund des Seins, dem alles entspringt und zu dem alles zurückkehrt. Brahman bedeutet das Absolute, nicht mehr Darstellbare. Die unzähligen Götter im Hinduismus sind Aspekte ein und desselben. Aus Brahman entsteht Atman, der Atem, der Odem des Lebens. Atman ist das innere Licht im Menschen, seine unzerstörbare Mitte. Im Schöpfergott Brahma ist Brahman personifiziert. Während des Sterbens flüstert Shiva das befreiende Mantra in das Ohr des Sterbenden, glauben die Hindus.
Nach dem Mittagessen sitzen wir an den Ghats. Als es dämmert, sehen wir in der Ferne die Feuer der Verbrennungsstätten leuchten. Ein junger Inder führt uns dahin. Von der obersten Stufe der Ghats blicken wir über eine Mauer hinunter auf den Ort des Geschehens. „Über die Leichen der Frauen breitet man bunte, über die der Männer weiße Tücher“, sagt unser Führer. „Mittags um zwölf Uhr beginnt man mit den Verbrennungen. Sie dauern die ganze Nacht an“. Sechs Scheiterhaufen brennen gerade. Die Flammen lodern, die Funken sprühen, zwei in weiße Tücher gehüllte Leichen liegen am Ufer des Ganges zur Einäscherung bereit.
Mit großem Geschick leitet uns der Inder in eine der vielen Seidenfabriken, in denen die feinen Brokate Vārānasis hergestellt werden. Wir glauben an eine freundliche Einladung, als Tee gereicht wird. Im Nu breitet der Händler unzählige Saris vor uns aus. Der Preis richte sich nach der Anzahl der Farben und der Vielfalt der Muster, erzählt er uns. Schöne Arbeiten sind darunter. Aber kaufen? Wir sind unterwegs, der Rucksack ist schwer genug. Nach einer Weile lavieren wir uns höflich aus dem Laden heraus, ohne etwas gekauft zu haben, gucken dem Treiben an den Ghats zu und laufen durch die engen, schmutzigen Gassen. Ich bin erstaunt über den Schmutz in den Straßen. Die Ecken stinken. Unrat bedeckt den Boden, Gemüsereste, Papier, Asche, Schutt und Kehricht. Ist das etwa das indische Leben in Reinkultur?

Die Bilder und Szenen an den Ghats sind malerisch, den offenen Verbrennungsstätten stehen wir mit gemischten Gefühlen gegenüber. Sie wirken befremdlich und wenig einladend auf uns mit unserer westlichen Mentalität. Mir erscheint die Atmosphäre düster und bedrückend, obwohl dieser berühmte Pilgerort gleichzeitig eine Faszination ohnegleichen ausströmt.
Am Sonntagmorgen klingelt der Wecker um halb sechs. Wir stehen auf, um die Waschungen der Hindus an den Ghats zu beobachten. In der Dunkelheit ist nicht viel los, aber die Treppenstufen füllen sich langsam. An Ständen kaufen Männer und Frauen Seife, Farbpuder, Blütenblätter und alles, was sie für ihre Rituale benötigen. Prächtig geht die Sonne über dem Ganges auf und taucht den Fluss, die Ghats, Tempel, Häuser und Menschen in goldenes Licht. Ihr Glanz verdrängt das Unbehagen, das die Seele manch eines westlichen Besuchers angesichts der vielen fremdartigen Eindrücke erfasst. Varanasi erstrahlt.

Wir mieten uns ein Ruderboot für eine Stunde und schippern los. Vom Wasser aus sehen wir dem Treiben der Menschen zu. Die Gläubigen opfern Blumen und Weihrauch, sie schreiten hinunter in die schmutzigen Fluten, tauchen unter und vollführen ihr rituelles Bad. Sie waschen ihre Kleider und trinken andächtig das heilige Wasser, in dem der Unrat der Stadt schwimmt. Sie haben keine Angst, krank zu werden. Die Macht des Glaubens ist offensichtlich stärker als die Kolibakterien, die das Wasser verseuchen, die Kraft des Geistes bändigt das Stoffliche.
Unser Bootsführer ist lahm und hat keine Lust, zu den Verbrennungsplätzen zu rudern. Wir handeln eine zusätzliche halbe Stunde aus und nähern uns den Scheiterhaufen. Auch von weitem ist das Fotografieren dieser Plätze kaum möglich. Ein Wächter schreit, als ich die Kamera hebe. Nur gegen ein Bakschisch dürfe ich die Szenen im Bild festhalten, meint der Bootsführer. Eingehüllte Leichen liegen im lodernden Feuer oder neben den aufgeschichteten Holzstößen. Wir halten freiwillig Abstand. Uns reicht es, das Schauspiel aus der Ferne zu sehen. Wir lassen uns an einem der Ghats absetzen und stürzen uns ins Menschengewühl. Auf jeder Treppenstufe sitzen Bettler und strecken ihre Hände aus. Sie kommen aus ganz Indien und hoffen auf die Freigebigkeit der Gläubigen, die sich gerade im Ganges von ihren Sünden reingewaschen haben.

Dreißig Jahre später liegt Varanasi wieder auf meinem Weg. Als ich am Morgen von Nepal nach Indien einreise, finde ich einen Taxifahrer, der gerade Touristen von Varanasi zur Grenze gebracht hat. Er ist froh, wenn er nicht mit leerem Wagen zurückfahren muss. Wir handeln einen Preis von achthundert Rupien aus, etwa zwölf Euro. (1 Euro = 68 indische Rupien). Unterwegs steigen Leute zu und wieder aus. Bei der Ausfahrt aus Gorakhpur stehen wir mindestens eine Stunde im Stau. Auf freier Strecke gibt der Fahrer Gas. Er fährt sehr umsichtig. Mit seinem schneeweißen Toyota geht er extrem pingelig um. Schlaglöcher durchfährt er langsam, um die Stoßdämpfer seines Autos zu schonen. Er habe zwei Söhne und eine Tochter, erfahre ich. Um siebzehn Uhr erreichen wir nach zehnstündiger Fahrt Varanasi. Er hinterlässt mir seinen Namen und seine Telefonnummer und organisiert eine Fahrradrikscha für mich, die mich zum Alka-Hotel am Mir-Ghat bringen soll. Sechsunddreißig Stunden habe er nicht geschlafen, meint er mit roten, müden Augen.
Ich steige um in die Rikscha und der ergraute Mann tritt mit seinen dünnen Beinen in die Pedale. Ist gerade Rush Hour oder sind die Straßen immer so voll? Im tosenden und wogenden Verkehrsgetümmel schalte ich das Denken ab und versuche mich zu entspannen. Dieser bunte Strom von Autos, Motorradfahrern, Rikschas, Scootern, Fußgängern und Tieren wird uns zerquetschen. Mein Fahrer fährt millimetergenau an anderen Fahrzeugen vorbei. Immer wieder stehen wir im Stau, es geht nicht vor und nicht zurück. Hupen, Klingeln, Motorbrummen und Stimmengewirr füllen meine Ohren. In stoischer Ruhe steht ein schmutziger Hund am Straßenrand und kratzt sich. An einer anderen Stelle versucht ein Hirte seine Herde Kühe mit Gepfeife zusammenzuhalten. Und dann geht es schließlich gar nicht weiter. Wir stehen. Mein Fahrer weiß gar nicht, wo sich das Alka-Hotel befindet. Er fragt einen jungen Inder. Der meint, nur zu Fuß käme ich weiter. Die Gassen seien zu eng für eine Rikscha. In fünf Minuten wäre ich im Hotel, er würde mich führen. Ich steige aus, er läuft voraus. Ich renne schwitzend hinterher. Einige Gassen liegen dunkel, andere sind erleuchtet von dem Licht glänzender Shops, in denen man Seide und Brokat verkauft. Und dann sind wir nach etwa fünfzehn Minuten endlich am Ziel! Der Junge hat mir einen riesigen Freundschaftsdienst erwiesen. Den ganzen Tag über hatte ich Glück. An der Grenze wurde ich freundlich empfangen, ein Mann half mir beim Geldumtausch und verwies mich auf den netten Taxifahrer. In einer zerbrechlichen Rikscha überlebte ich das bedrohliche Chaos auf Varanasis Straßen und jetzt bin ich am Ziel. Im Alka-Hotel bekomme ich im ersten Stock ein Zimmer mit Bad. Durch das vergitterte Fenster blicke ich hinunter auf den dunklen Ganges und hinauf zu den Sternen. Willkommen in Indien!
Schon um vier Uhr in der Nacht bimmelt eine Glocke und jemand begrüßt den heraufziehenden Tag mit seinem Flötenspiel. Zum Sonnenaufgang gehe ich hinunter zu den Ghats. Ruder- und Motorboote liegen für die Touristen am Ufer. Auf Schritt und Tritt spricht man mich an: „Boat? You want a boat? Madam, boat?“ Nein, Madam möchte kein Boot, später in den Gassen auch keine Seide, keinen Scooter und keine Rikscha.

Gläubige waschen sich im Ganges, steigen ins Wasser, die Männer in Unterwäsche, die Frauen in ihren Saris. Sie tauchen unter und heben ihre Hände zum Gebet. Sie glauben an die Heiligkeit des Wassers, füllen es in Flaschen und Kannen, trinken es aber nicht mehr wie vor dreißig Jahren. Sie gießen es auf Blumen und die kleinen Statuen in den Schreinen. Sie huldigen der Göttin Ganga und setzen Öllichter ins Wasser. Priester auf Podesten sitzen unter zerfledderten Sonnenschirmen, lesen in den heiligen Büchern und tupfen den Gläubigen für zehn Rupien die Thika, den roten Punkt auf die Stirn, das Zeichen dafür, dass sie ihre Morgenandacht verrichtet haben. In Erwartung einer Spende winken sie auch Touristen zu. Sadhus in orangefarbenen Tüchern, das Gesicht grell bemalt, erheben segnend ihre Hände.

Auf den oberen Treppenstufen stehen Schreine. In einem Meer von Studentenblumen entdecke ich Hanuman, den Affengott, und Ganesha, den beliebten Elefantengott, der Hindernisse beseitigt und hilft, Probleme zu lösen. Am Asi-Ghat, dem südlich gelegenen Endpunkt der kilometerlangen Treppenfluchten, stehen rund um einen Feigenbaum auf tischhohem Absatz mehrere Lingams, dazwischen kleine Statuen des Nandi-Stiers. Blumen, Blütenblätter, grüne Blätter, Pflaumen und Äpfel liegen verstreut dazwischen. Eine Ziege steht auf dem Altar und labt sich an all den Köstlichkeiten, die den Göttern zugedacht waren. Niemanden stört es.
Unter der Schicht des Lichten und Erhabenen liegen der Schmutz und der Dreck, auch an den Ghats. Viele Ecken stinken nach Urin. Abfall liegt herum. Während des Monsuns muss der Ganges über seine Ufer getreten sein. Meterhohe Erdschichten füllen noch einige Ecken der Ghats. Männer spritzen sie mit zischendem Strahl aus dicken Wasserschläuchen langsam aber sicher weg. Das benötigte Wasser wird aus dem Ganges hochgepumpt.

In den Gassen geht es zu wie vor dreißig Jahren. Seiden- und Brokat-Shops reihen sich aneinander, in einem Kosmetikladen stehen die Regale voll mit wohlriechenden Ölen und Parfumflaschen. Westliche Produkte gibt es jetzt zu kaufen, Gesichtscremes, Seifen, Körpermilch und Deostifte. Dazwischen liegen Kodakfilme und Batterien. Händler verkaufen in ihren Kramläden Mehl, Zucker, Getränke und Gemüsedosen, in kleinen Restaurants gibt es Currys mit Chapati und in der German Bakery dunkles Brot, Omelett, Milchkaffee und Käsekuchen. Internetcafés sind entstanden. An einer Hausecke verkauft ein Mann die golden eingerahmten Fotografien verwelkter Männer- und Frauengesichter, die verstorben sind. An einer anderen kann man die Bildnisse des Gottes Shiva und seiner Gefährtin Parvati erstehen. Ziegen stöbern in stinkenden Abfallhaufen herum. Kühe stehen im Weg, nehmen fast die gesamte Breite an engen Stellen ein und die Passanten drücken sich daran vorbei. Wenn das Tier bloß nicht mit seinem Schwanz um sich schlägt!
Am Eingang des Basarviertels werden Teigtaschen in heißem Öl frittiert. Große Eisenschalen hängen über lodernden Flammen in den Öffnungen der Lehmöfen. Nebenan wird Milch über einem Holzfeuer abgekocht. Ein durchlöchertes Eisenfass dient als Ofen.
Varanasi ist eine faszinierende Welt, die alle Seiten des Daseins umfasst, die Götter, die Altäre, Schreine, Tempel, die Gläubigkeit der Menschen auf der einen Seite, auf der anderen das Profane, die Shops, den Profit, das Geld, die Gier, Kühe, Ziegen, die Abfallhaufen und die Schmeißfliegen darauf.

In Nepal: Die meisten Trekker steigen zum Everest Base Camp auf. Dieser Völkerwanderung möchte ich mich nicht anschließen und entscheide mich für das Dudh-Kosi-Tal, das zum Fuße des achttausendzweihundert Meter hohen Cho Oyo führt und zum Ngozumpa-Gletscher, dem größten Nepals. Vom über fünftausenddreihundert Meter hohen Aussichtspunkt oberhalb des Sommerdorfes Gokyo soll man das Dreigespann Everest, Nuptse und Lhotse erblicken.
Hinter dem kleinen Kloster von Namche Bazar führt der Pfad steil den Hang an Gebetsfahnen vorbei hinauf nach Shyangboche. Ein Flugzeug am Himmel wirkt wie ein Vogel vor den riesigen Gebirgszügen. Eine hohe Tschörte krönt den Bergrücken und dahinter ragen die Schneeberge des Himalajas auf. Der Götterberg Ama Dablam erhebt sich wie ein dicker Daumen in den stahlblauen Himmel. Das „Matterhorn“ Nepals ist so markant wie der Machhapuchhare im Annapurna-Massiv. Mein Weg führt durch Khumjung, die größte Streusiedlung im Sherpaland, an langen Mani-Mauern und Tschörten vorbei hinab nach Phortse im Dudh-Kosi-Tal. Anstatt die Brücke nach Phortse zu benutzen, gehe ich geradeaus. Der Weg ist von dicken Felsbrocken, moosbehangenen Rhododendren, Magnolien und Wacholderbäumen, gesäumt. Wolken sind aufgezogen. Die Landschaft macht einen wilden Eindruck. Die Schneeberge, die noch kurze Zeit durch die Wolken lugen, sind zum Greifen nahe und wirken wie eine Erscheinung, gewaltig und unwirklich.

Die Sommerdörfer auf den Hochplateaus bestehen aus vereinzelt stehenden Steinhütten, die im Sommer bewohnt werden, wenn die Leute ihre Yaks zum Grasen auf die kargen Weiden schicken. Steinwälle begrenzen die kleinen Grasstücke. Gersten- und Kartoffelfelder breiten sich neben den Weiden aus.
Es ist neblig geworden und nasskalt. Die Steinhütten, an denen ich vorbeikomme, stehen leer. „Namaste! Guten Tag!“ Ich öffne eine Tür und stehe in einem Stall. Mich schaudert, wenn ich daran denke, im Freien übernachten zu müssen. Ein Flüsschen kreuzt den Weg. In dem dichten Nebel kann ich nicht erkennen, wo es auf der anderen Seite weitergeht. Ratlos verharre ich auf meinem Fleck, umhüllt von Wolkenschwaden, die die Welt verschluckt haben. Wie ein Wunder taucht eine Gestalt hinter mir auf, ein Jugoslawe. Er überquert mit mir den Fluss und bringt mich zu einer fünfzig Meter entfernten Hütte. Acht Trekker drängen sich schon um die Feuerstelle. Ich solle weitergehen, meinen sie, in der Nähe gäbe es einen Tea-Shop, in dem ich übernachten könne. Für mich ist es ein Ding der Unmöglichkeit, in diesem Nebel einen Tea-Shop zu finden. Keine zehn Pferde können mich mehr vertreiben.
Die Hausfrau bereitet für uns die Abendmahlzeit zu. Bester Laune, trotz der erbärmlichen Kälte, die in der staubigen Steinhütte herrscht, stürze ich mich heißhungrig auf Dhal Bat und schlürfe genießerisch den heißen Tee, den sie uns serviert. Ich befinde mich im Sommerdorf Dole in fast viertausend Meter Höhe.

Sechs Stunden Fußmarsch trennen mich von Gokyo, einem Sommerdorf, das am Ende des Tals liegt. Um mich besser zu akklimatisieren, will ich an einem Tag nur dreihundert bis vierhundert Höhenmeter aufsteigen und in Luza oder Machermo übernachten. So habe ich viel Zeit, um mir immer wieder die gewaltige Landschaft anzugucken.
In Machermo steht eine Hütte offen. Ich trete ein und komme gerade richtig, um eine Nudelsuppe mitessen zu können. Ein Holländer und zwei Deutsche haben sich häuslich niedergelassen. Ich setze mich dazu. Im Laufe des Nachmittags wird es bitterkalt. Die Hütte besitzt keinen Schornstein und der Rauch des Feuers treibt uns die Tränen in die Augen. Vermummt in Anorak und Mütze klettere ich nachts in den Schlafsack und friere immer noch. Draußen und drinnen herrschen Minustemperaturen.
Das morgendliche Aufstehen in den Steinhütten vollzieht sich nach einem bestimmten Ritual: In der Dämmerung entfacht die Frau des Hauses das Feuer und kocht Tee. Wenn der fertig ist, können wir es wagen, die Nase aus dem Schlafsack zu stecken. Einer nach dem anderen steht auf, greift zum Tee und wärmt die kalten Finger an der Blechtasse. Jeder schlürft den heißen Tee und zittert sich warm. Manchmal bringt die Frau das dampfende Getränk an den Schlafsack. Das ist dann der erste Höhepunkt des Tages und unsere Dankbarkeit kennt keine Grenzen.
Heute Morgen ist es bewölkt. Es dauert eine Weile, bis ich mich warm gelaufen habe. Vor mir ragt der gut achttausendeinhundertfünfzig Meter hohe Cho Oyu auf, hinter mir der fast sechstausendachthundert Meter hohe Kantega im Süden. Die Baumgrenze ist überschritten. Der Aufstieg durch die Endmoräne des Ngozumpa Gletschers nach Gokyo beginnt. Ich merke die dünne Luft.
Der Fluss sucht sich seinen Weg durch die Geröllmassen und stürzt zu Tal. Der steinige Pfad führt am ersten türkisgrünen See vorbei. Er leuchtet im Grau der Gesteinsmassen auf. Vor einer Felswand kreist ein Riesenvogel, ein Adler. Schließlich der zweite See unterhalb einer schroffen Felswand und einer Handvoll Hütten, Gokyo. Trotz der Sonne, die durchgekommen ist, überwiegt die Kälte. Aus einer Hütte steigt Rauch auf, sechs Trekker sitzen um die Feuerstelle. Einige haben draußen ihre Zelte aufgeschlagen.
Gokyo liegt viertausendsiebenhundertfünfzig Meter hoch. Zu sieben Personen schlafen wir nachts dicht an dicht in der engen Hütte. Es geht soeben. Mehr Leute fänden keinen Platz. Es ist wärmer als in den zwei vorausgegangenen Nächten, dennoch liege ich mit voller Bekleidung im Schlafsack, die Mütze über die Ohren gezogen, eingemummt in Pullover und Anorak. Die Kälte schlägt auf die Blase. Mit großer Überwindung zwinge ich mich jede Nacht aus der Kälte des Schlafsacks in die noch größere Kälte draußen. Dann blicke ich hinauf in einen sternübersäten Himmel. Wie nah die Sterne sind! Doppelt so viele wie gewöhnlich zeigen sich. Ein Lichtermeer glitzert am tiefschwarzen Firmament. Am Morgen bringen unsere Gastgeber den köstlichen Tee an den Schlafsack. Ein erstklassiger Service! Solch schöne Erlebnisse wird man niemals in einem Luxushotel haben!
Der Himmel ist mit Schneewolken verhangen. Ein Aufstieg zum Aussichtspunkt lohnt sich nicht. Einem Kanadier kaufe ich ein Brot ab und frühstücke in aller Ruhe. Ich bin drauf und dran, faul am Feuer sitzen zu bleiben, raffe mich aber zu einem Spaziergang auf und erklettere einen Hügel hinter Gokyo. Plötzlich fällt der Hang senkrecht vor mir ab: Unter mir breiten sich die Gletschermassen aus und füllen das Tal kilometerweit mit Schutt, Geröll, Staub, Schnee und Gletscherspalten. Ich hocke mich an die Kante und höre Steine in die Tiefe poltern. In der Totenstille wirken die Geräusche gespenstisch. Der bedeckte Himmel passt zur Wildheit dieser Szene. Ein fahlgelbes Wiesel huscht an mir vorbei. Wir beiden scheinen die einzigen Lebewesen weit und breit zu sein. Durch Geröll und Felsen steige ich nach Gokyo ab. Es gibt eine Nudelsuppe mit Kartoffeln. Ein Deutscher und eine Engländerin sind eingetroffen, mit Utz, einem Schweizer spiele ich Schach. Den Rest des Tages sitzen wir an der qualmenden Feuerstelle und reiben uns die tränenden Augen.

Am nächsten Morgen lacht die Sonne. Nach dem Frühstück nehme ich den Aussichtshügel in Angriff. Langsam, langsam! Die Lunge pfeift, der Schritt wird schwer. Die letzten Meter bereiten mir die größte Mühe. Immer wieder bleibe ich stehen, um die dünne Höhenluft in die Lungen zu pumpen. Endlich geschafft. Fünftausenddreihundert Meter! So hoch war ich noch nie im Leben. Und vor mir der höchste Berg der Erde, ein Dach aus Schnee und Eis. Davor steht der Lhotse neben dem Nuptse. Der Cho Oyu schließt das Tal ab, der Makalu erhebt sich im Osten. Der Cholatse in nächster Nähe imponiert mir am meisten. Er besteht aus einer schneebedeckten Felskante, die den blauen Himmel durchschneidet. Unten im Tal liegen die smaragdgrünen Seen und das Sommerdorf Gokyo am mächtigen Gletscherstrom, der sich ins Tal hinunter schiebt.
Die Kälte und ein brennender Durst treiben mich nach Gokyo zurück...